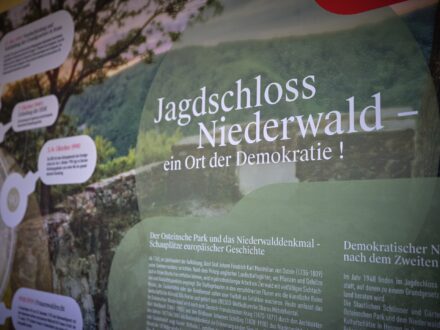Entdecken Sie Hessens eindrucksvolle Schlösser, Gärten, Klosteranlagen, Burgruinen, Monumente & Geschichten.
Aktuelle Themen
Die Kaiserlichen Appartements im Schloss Bad Homburg
Das mittelalterliche Kloster Konradsdorf in der Wetterau
Aktuelle Veranstaltungen
-
![Abendspaziergang Eremitage Abendspaziergang Eremitage]()
Bensheim-Auerbach
26.04.
18:00–19:30FührungJugendlicheErwachseneBensheim-Auerbach
+++AUSGEBUCHT+++Abendspaziergang zur Eremitage
Abendspaziergang mit kleiner Vesper
Mehr erfahren -
![Escape Kids Mission 2 Leukel Escape Kids Mission 2 Leukel]()
Bad Homburg v. d. Höhe
27.04.
13:30–15:00MitmachangebotKinderBad Homburg v. d. Höhe
Escape Kids "Das rätselhafte Tagebuch"
Escape Kits Games
Mehr erfahren -
![Eine Zeitreise ins Mittelalter Leukel Eine Zeitreise ins Mittelalter Leukel]()
Münzenberg
28.04.
12:00–13:00FührungKinderErwachseneMünzenberg
Eine Zeitreise ins Mittelalter
Öffentliche Burgführung
Mehr erfahren